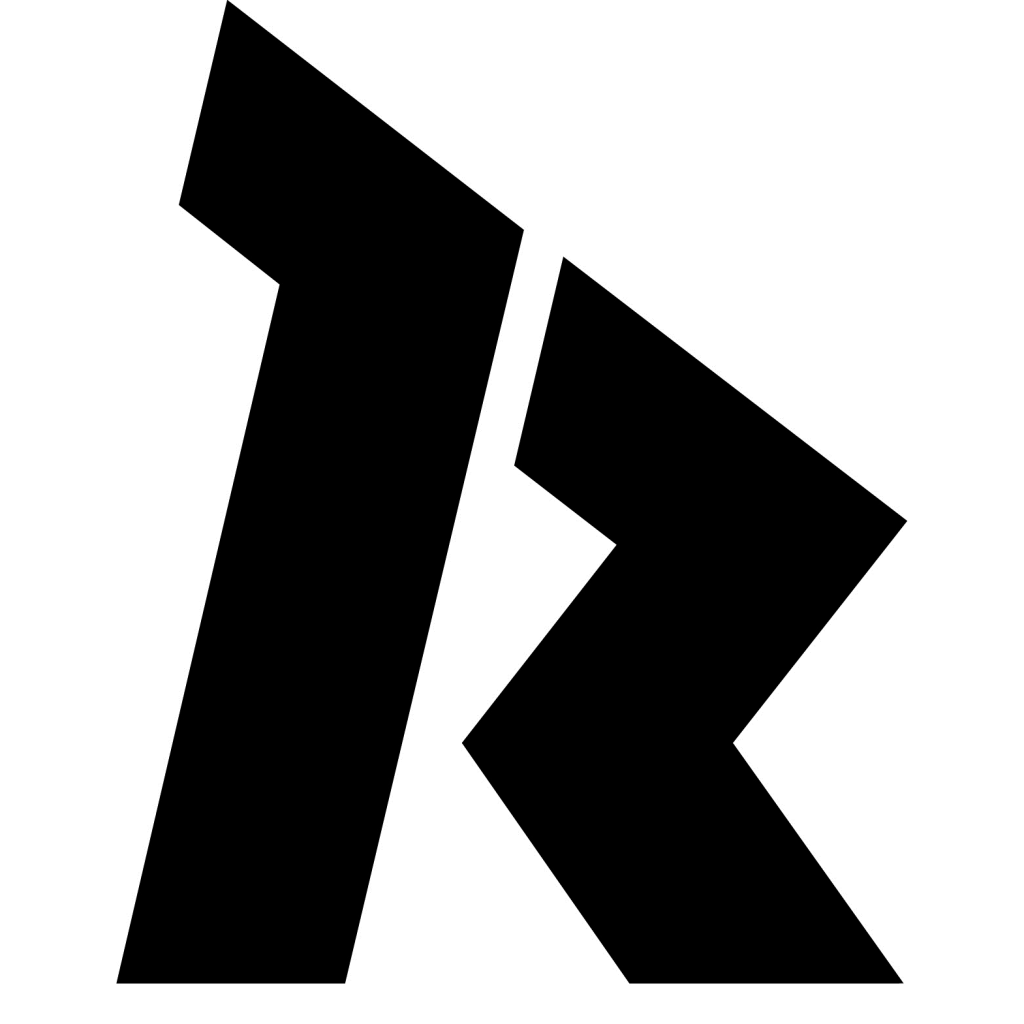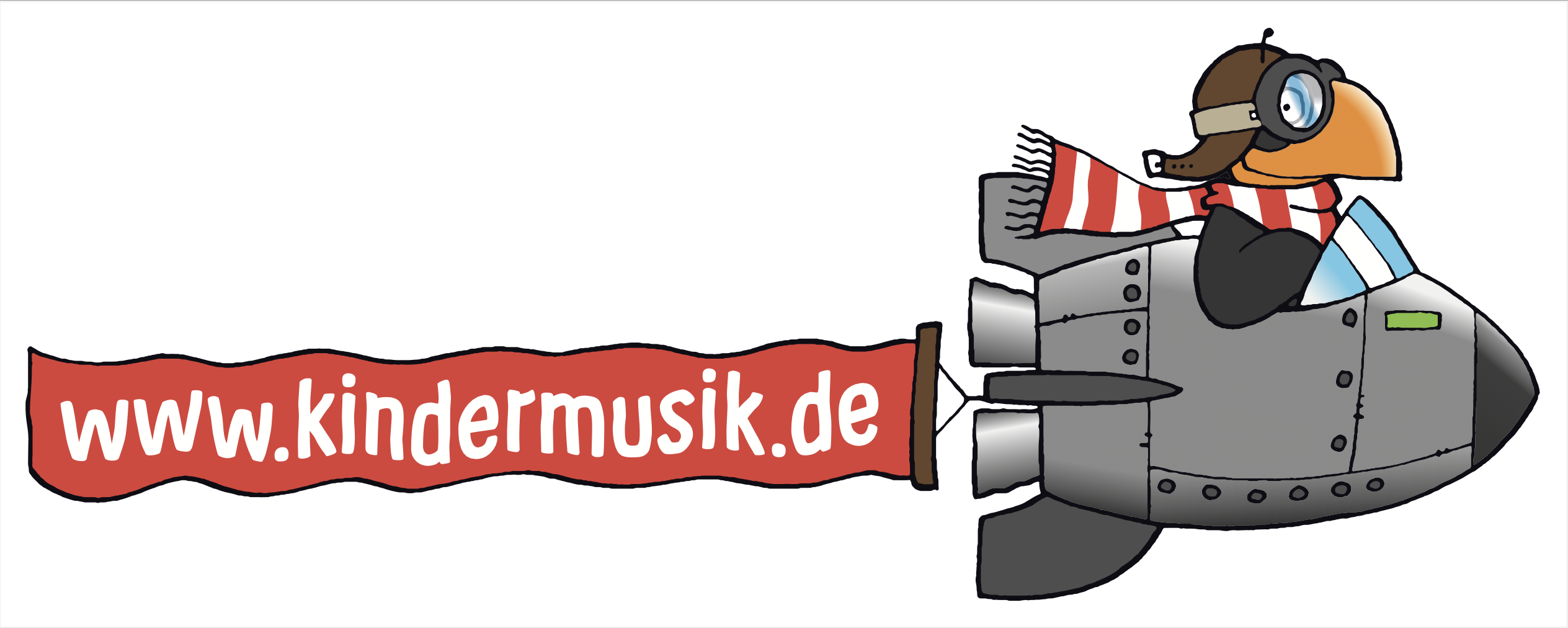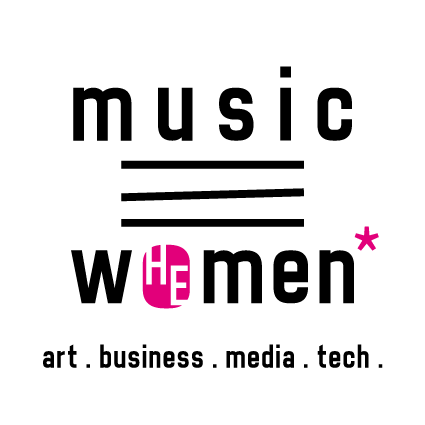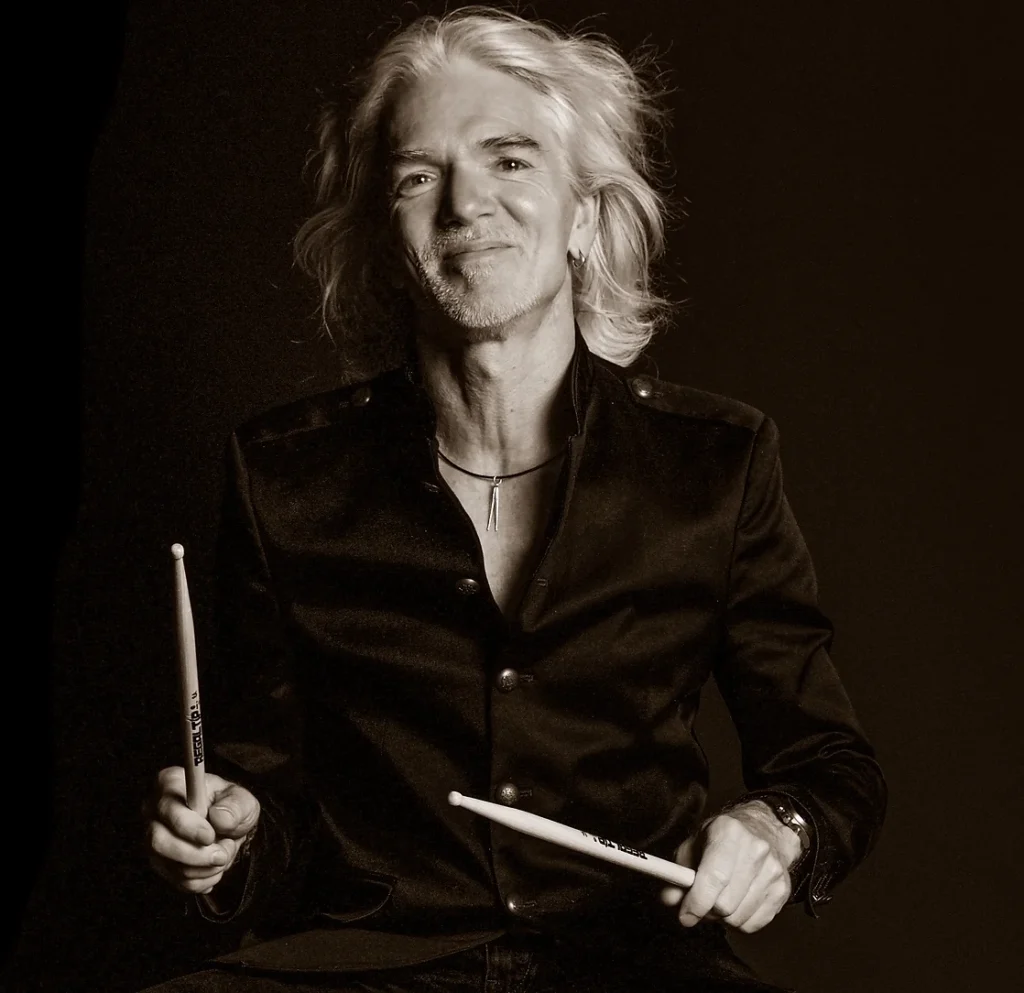Aktualisiert: 6. Juli 2023
Teil 5: Berufsalltag als Opernsänger*in
Geht man in die Oper und sieht die Sänger*innen auf der Bühne oder die Musiker*innen im Orchestergraben, denkt man sich vielleicht: »Das möchte ich auch können!« (Oder das etwas weniger schmeichelhafte »Das kann doch nicht so schwer sein!«) Doch wie schwer ist es eigentlich, klassische Musiker*in zu werden? Dieser Frage möchten wir in diesen Beiträgen nachgehen. Nachdem wir im letzten Artikel die Orchestermusiker*innen vorgestellt haben, werden wir in diesem Beitrag den Berufsalltag der Opernsänger*innen schildern.
Teil 1: Musikunterricht in der Kindheit
Teil 2: Bewerbung zum Studium
Teil 3: Verschiedene Studiengänge
Teil 4: Berufsalltag als Orchestermusiker:in
Teil 5: Berufsalltag als Opernsänger:in
Teil 6: Berufsalltag als Musikpädagog:in
Teil 7: Berufsalltag der freien Musiker:innen
Teil 8: Sichtbarkeit und öffentliche Wahrnehmung der klassischen Musik
Studierende im Fach Gesang wollen oft Opernsänger*in werden. Berufsbild und Bewerbungsverfahren ähneln dem der Orchestermusiker*innen. Es gibt allerdings einen großen Unterschied: Grundsätzlich gibt es für Gesangssolist*innen an Opernhäusern keine unbefristeten Verträge! Sogenannte Festverträge werden für ein oder zwei Jahre abgeschlossen. Anschließend wird der Vertrag so lange verlängert, bis Opernhaus oder Sänger*in keine Verlängerung mehr wünschen. Das geht allerdings nicht beliebig oft: Nach 15 Jahren Ensemblezugehörigkeit wird ein Vertrag »unkündbar«, d.h. der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Vertrag zu entfristen (Stichwort »Kettenvertrag«). Manche Opernhäuser achten darauf, dass das nicht passiert, und stellen lieber neue Sänger*innen ein. (Wenn Intendant*innen wechseln, wird auch gerne das komplette Ensemble ausgetauscht). Auch die Sänger*innen können sich nicht auf Vertragsverlängerungen verlassen und müssen sich rechtzeitig vor Ablauf dieser Frist um die weitere Karriere kümmern.
Neben den (befristeten) Festverträgen gibt es noch weitere Vertragsformen, bei denen man für einzelne Proben und Vorstellungen oder auch einen begrenzten Teil der Spielzeit engagiert wird. Ob diese Verträge sozialversicherungspflichtig sind, ist unterschiedlich. Beantwortet werden solche Fragen im NV Bühne. Dort sind auch viele weitere Details geregelt, zum Beispiel, wie viele freie Tage es pro Spielzeit gibt und welche Probenzeiten zulässig sind. An Opernhäusern entsteht oft der Eindruck, die Sänger*innen, die die Zuschauer*innen auf der Bühne sehen, seien fester Bestandteil des Ensembles. Doch das trifft nicht auf alle zu, und unbefristet fest angestellt sind Gesangssolist*innen, wie erwähnt, kaum einmal.
Das Bewerbungsverfahren bei Sänger*innen läuft ähnlich ab wie das Probespiel der Orchestermusiker*innen, allerdings spricht man bei Sänger*innen von einem »Vorsingen«, und anstatt des Orchesters sind Intendant*innen, Regisseur*innen oder Dirigent*innen des Hauses anwesend. Der Weg zu diesen Vorsingen ist noch einmal schwieriger als bei den Orchestermusiker*innen. Oft erfährt man von freien Stellen nur über Agenturen, bei denen man ebenfalls vorsingen muss!
Der Arbeitsalltag der Sänger*innen ist vielleicht noch härter als bei den Orchestermusiker*innen. Grundsätzlich ist die Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger (GDBA) für die gewerkschaftliche Unterstützung der Sänger*innen an Opernhäusern zuständig. In der Praxis ist die Situation aber oft nachteiliger für die Sänger*innen als beispielsweise bei den Orchestermusiker*innen. Die Gründe dafür sind komplex und würden den Rahmen dieses Artikels sprengen, allgemein kann man aber sagen, dass für eine stabile gewerkschaftliche Unterstützung ein fester und unbefristeter Arbeitsvertrag förderlich ist. Da dies bei Opernsänger*innen meistens nicht der Fall ist, ergeben sich für sie manchmal lange Anwesenheitszeiten, unvorteilhafte Verträge oder schlechtere Bezahlung. Selbst an kleinen Häusern ist beispielsweise eine Residenzpflicht im Vertrag möglich. Das bedeutet: Man darf die Stadt oder den Ort, an dem sich der Arbeitgeber befindet, auch außerhalb der Arbeitszeit nur mit dessen Erlaubnis verlassen. Begründet wird dies bei Sänger*innen damit, dass ein Ausfall einzelner Mitwirkenden einer Operninszenierung zum Ausfall der ganzen Produktion und damit zu erheblichen finanziellen Einbußen für den Arbeitgeber führen kann. In so einem Fall könnten dann die anderen Sänger*innen einspringen. Juristisch ist diese Vertragsklausel umstritten. Aber auch ohne Residenzpflicht wird der Alltag als Gesangssolist*in stark vom Probenplan bestimmt. Es ist beispielsweise üblich, dass die Sänger*innen erst am Vortag erfahren, ob und wann sie proben müssen.
Die Altersvorsorge bei Sänger*innen gestaltet sich oft schwierig, da sie ab einem gewissen Alter weniger oder gar keine Verträge mit Opernhäusern mehr bekommen. Sie müssen sich also schon während ihrer aktiven Karriere ein zweites Standbein zulegen, indem sie beispielsweise Gesangsunterricht erteilen oder einen ganz anderen Beruf ergreifen. Wird ein Vertrag der Gesangssolist*innen doch einmal entfristet (was selten vorkommt), kann der / die Sänger*in auch in anderen Bereichen des Opernhauses eingesetzt werden, zum Beispiel als Souffleur*in, als Sprachcoach oder sogar als Pförtner*in.
Ein großes Thema bei Sänger*innen ist die körperliche Gesundheit. Die Stimme ist ihre Einkommensquelle, daher müssen sie diese besonders gut pflegen. Das ist bei langen Proben und Aufführungen aber gar nicht so einfach! Besonders in der kalten Jahreszeit sind Sänger*innen sehr empfindlich, was Erkältungen und Grippe angeht. Von Corona sind sie natürlich auch besonders betroffen. Als Opernbesucher*in wundert man sich manchmal über die Ansagen vor Aufführungsbeginn, wer in dieser Inszenierung alles ausfällt, und wer trotz angeschlagener Stimme bereit ist zu singen. Das hat zwei Gründe: Zum einen singen Sänger*innen viele Partien pro Spielzeit und müssen mit ihren Kräften haushalten, zum anderen herrscht unter Sänger*innen ein großer Konkurrenzdruck. Viele Sänger*innen haben die berechtigte Sorge, dass jemand, der sie in Zukunft engagieren könnte, in einer Aufführung einen schlechten Eindruck bekommt und daher jemand anders engagiert.
Opernsänger*innen stehen bei einer Aufführung stärker im Fokus als die Instrumentalist:innen. Sie sind die ganze Zeit deutlich auf der Bühne zu sehen und müssen neben der musikalischen auch eine gewisse schauspielerische Leistung bieten. Am Ende wird ihnen beim Schlussapplaus zugejubelt, während für die Orchestermusiker*innen nur stellvertretend die Dirigent*innen die Ovationen entgegen nehmen. Da ist es für viele vielleicht verwunderlich, dass man als Opernsänger*in tatsächlich weniger verdient als die Kolleg*innen im Orchestergraben. Die Gründe dafür sind vielfältig, eine Rolle spielt aber sicherlich der starke Konkurrenzdruck und die oben erwähnte schwierige gewerkschaftliche Situation.
Dank geht an den Tenor Jan Kristof Schliep (www.jankristofschliep.com) für seine Anregungen und Anmerkungen.
Autor*in
-

Daniel Mattelé studierte Musik mit Hauptfach Harfe an den Musikhochschulen in Weimar, Detmold und München, wo er ein künstlerisches Diplom erwarb. Bis vor der COVID-19-Pandemie war er als freier Orchestermusiker tätig. Zusammen mit seiner Partnerin Laura Oetzel gibt er regelmäßig Kammermusikkonzerte als Harfenduo und betreibt den Blog dasharfenduo.de, auf dem über Themen aus der klassischen Musikszene berichtet wird. Schwerpunkte dieser Berichterstattung sind Beiträge über die #metoo-Bewegung sowie über Arbeitsbedingungen für Musiker:innen.
Bei PRO MUSIK baut Daniel als Mitglied der Redaktionsleitung das PRO MUSIK Magazin auf. Er ist Mitglied bei der Deutschen Orchestervereinigung (DOV) sowie im Verband der Harfenisten in Deutschland e. V.