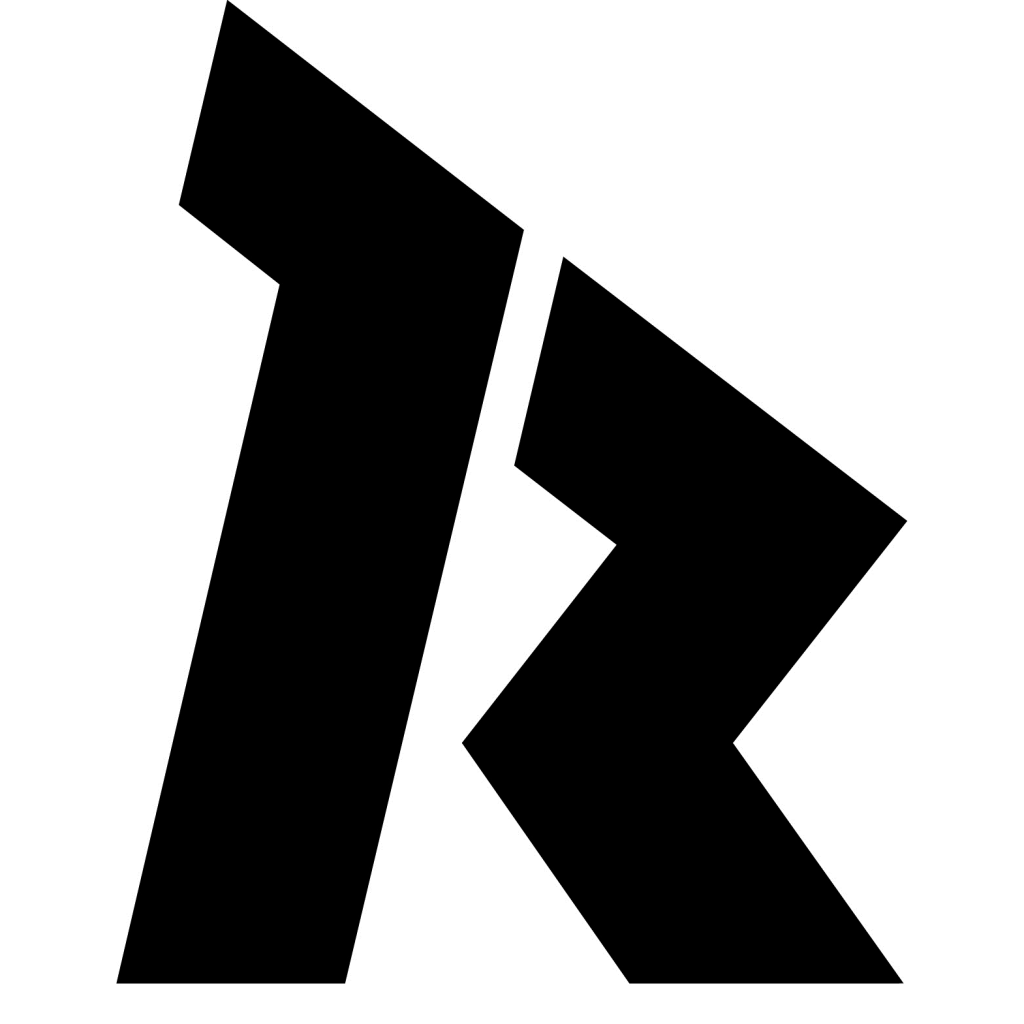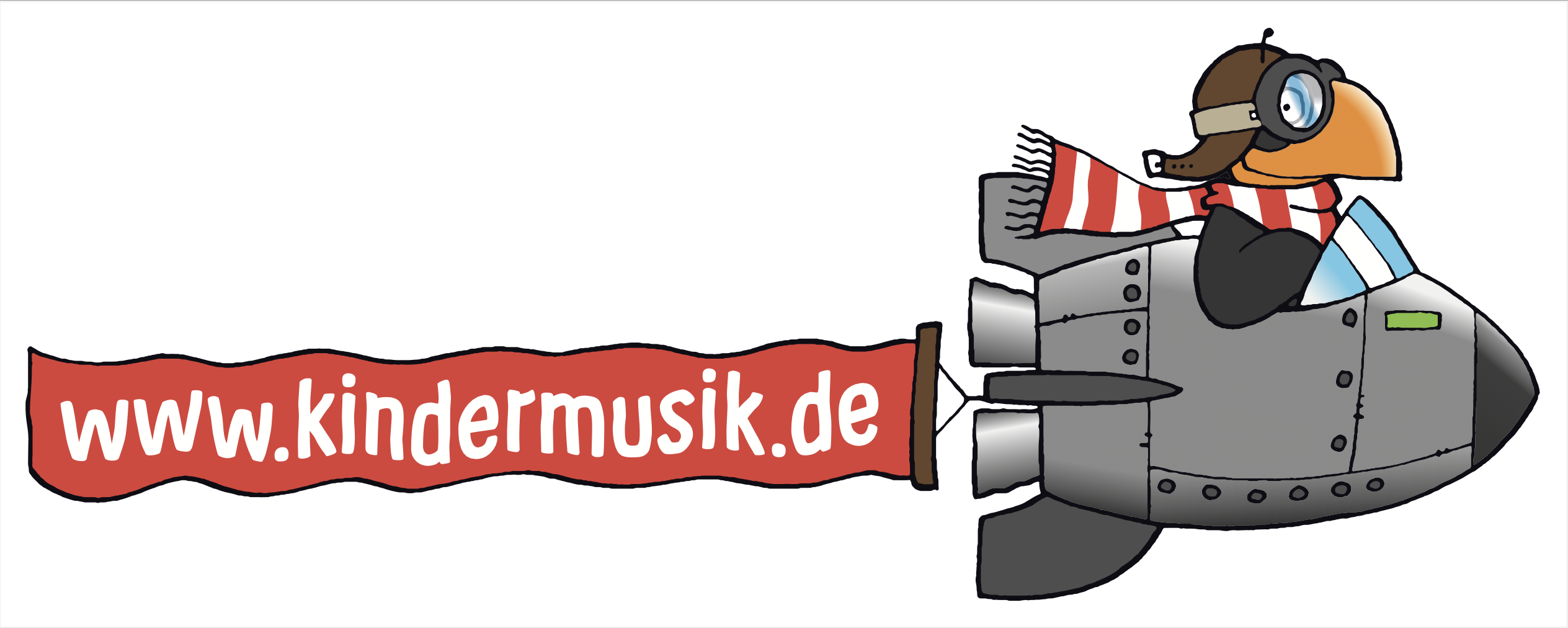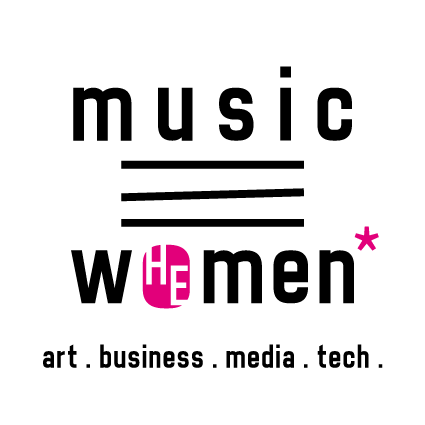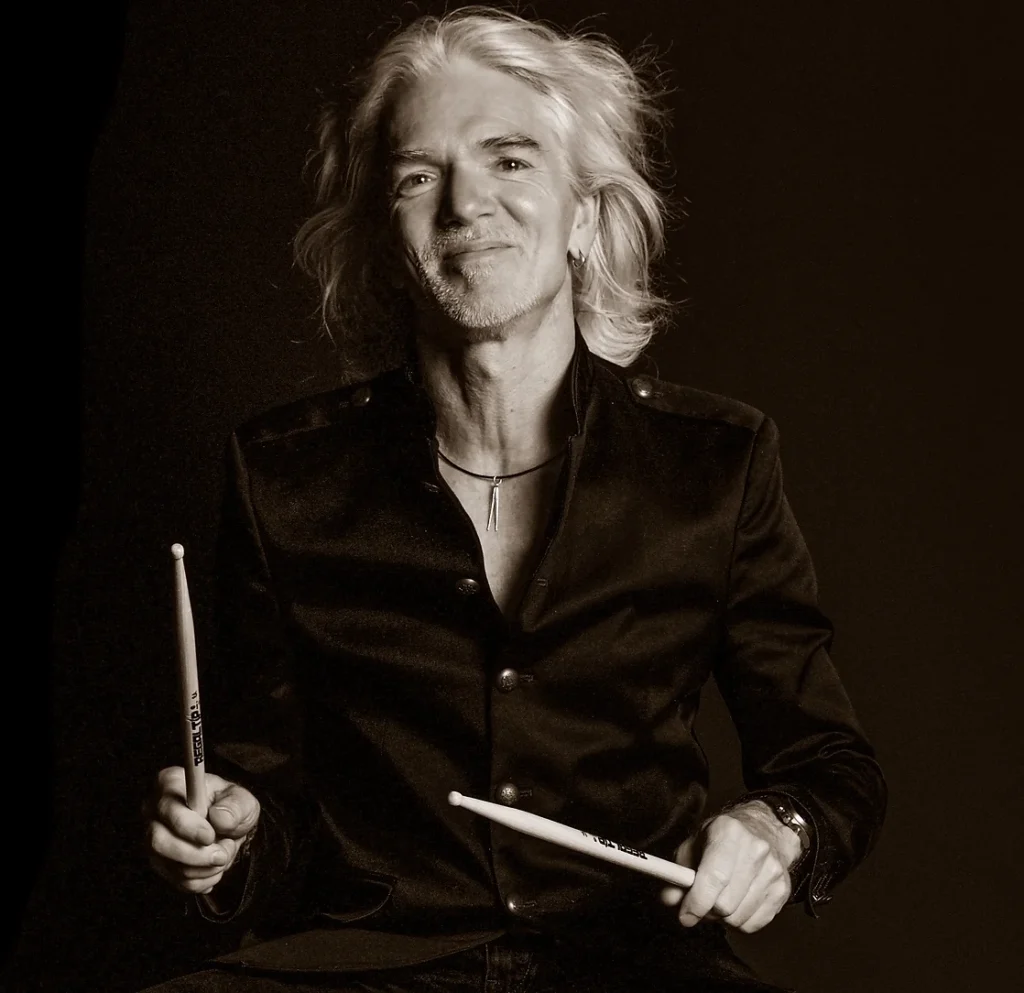Aktualisiert: 6. Juli 2023
Teil 4: Berufsalltag als Orchestermusiker*in
Geht man in die Oper und sieht die Sänger*innen auf der Bühne oder die Musiker*innen im Orchestergraben, denkt man sich vielleicht: »Das möchte ich auch können!« (Oder das etwas weniger schmeichelhafte »Das kann doch nicht so schwer sein!«) Doch wie schwer ist es eigentlich, klassische Musiker*in zu werden? Dieser Frage möchten wir in diesen Beiträgen nachgehen. In den folgenden Artikeln möchten wir ein paar Berufsfelder der klassischen Musik vorstellen. Den Anfang machen die Orchestermusiker*innen.
Teil 1: Musikunterricht in der Kindheit
Teil 2: Bewerbung zum Studium
Teil 3: Verschiedene Studiengänge
Teil 4: Berufsalltag als Orchestermusiker*in
Teil 5: Berufsalltag als Opernsänger*in
Teil 6: Berufsalltag als Musikpädagog*in
Teil 7: Berufsalltag der freien Musiker*innen
Teil 8: Sichtbarkeit und öffentliche Wahrnehmung der klassischen Musik
Das Berufsziel derjenigen, die ein Orchesterinstrument spielen, ist häufig, in einem Orchester zu spielen. Um eine feste Orchesterstelle zu erreichen, muss man einen langen Atem haben. Manchmal bewerben sich Dutzende oder gar Hunderte Musiker*innen auf eine einzige Stelle. Bei der Bewerbung kommt es nicht so sehr auf den Studiengang oder die Abschlussnote an, sondern es wird eher darauf geachtet, ob man über Orchestererfahrung verfügt. Wer schon einmal ein Praktikum oder eine befristete Stelle in einem anderen Orchester hatte, hat gute Karten, zum Probespiel eingeladen zu werden. Es ist also durchaus möglich, ein Schulmusikstudium abzuschließen und sich anschließend erfolgreich für eine Orchesterstelle zu bewerben. Genauso ist es möglich – wenn auch sehr selten –, dass man eine Stelle bekommt, ohne Musik studiert zu haben. In der Regel wird man aber einen künstlerischen Musikstudiengang abgeschlossen haben, bevor man sich bewirbt.
Das Probespiel ist das eigentliche Bewerbungsverfahren. In einer Art Wettbewerb treten alle Bewerber*innen gegeneinander an und spielen vorher festgelegte Solostücke sowie bekannte Passagen aus der Orchesterliteratur. Dabei wird man nicht wie im »Ernstfall« vom ganzen Orchester unterstützt, sondern muss seine eigene Stimme ganz »nackt« vorspielen – unter den Augen und Ohren aller zukünftigen Kolleg*innen! Ein Probespiel kann über mehrere Runden gehen, bei denen dann jeweils Musiker*innen »ausgesiebt« werden, bis die zukünftigen Kolleg*innen den / die Gewinner*in ausgewählt haben. Wer nun denkt, dass man nach gewonnenem Probespiel seine Stelle sicher hätte, irrt: Die meisten Orchester legen eine Probezeit von einem Jahr fest, an deren Ende von den Musiker*innen abgestimmt wird, ob die / der Bewerber*in einen festen Vertrag erhält. Es ist in Einzelfällen sogar möglich, dass diese Probezeit um ein weiteres Jahr verlängert wird! (Es könnte ja sein, dass sich die Bewerber*innen doch noch als Hochstapler*innen herausstellen 😉 ) Bei diesen hohen Hürden ist es nicht verwunderlich, dass manche angehenden Orchestermusiker*innen über viele Jahre hinweg immer wieder an Probespielen teilnehmen, bevor sie eine feste Stelle bekommen. Manche schaffen es nie und müssen sich beruflich anders orientieren. Es ist im Übrigen äußerst unüblich, dass eine Person, die ein Praktikum im Orchester gemacht hat, im Anschluss fest übernommen wird. Auch wenn die Praktikant*innen gewiss einen Vorteil haben, müssen sie wie alle anderen Bewerber*innen auch ein erneutes Probespiel absolvieren.
Die meisten Orchestermusiker*innen werden der Aussage zustimmen, dass ihre Arbeit hart ist und nicht immer viel mit künstlerischem Ausdruck zu tun hat. Innerhalb kürzester Zeit werden ganze Opern, Ballette und Sinfonien geprobt und häufig Dutzende Male aufgeführt. Bei Sinfoniekonzerten wird oft erst eine Woche vor der Aufführung mit den Proben begonnen. Bei Opern und Balletten gibt es mehr Probenzeit, da nach den Orchesterproben noch mit Sänger*innen bzw. Tänzer:innen geprobt werden muss. Die Arbeitszeiten als Orchestermusiker*in sind gewöhnungsbedürftig. Wer beispielsweise einmal eine Wagner-Oper live gehört hat, wird den Abend (hoffentlich) als angenehme Freizeit erlebt haben. Dabei vergisst man schnell, dass dies für die Mitwirkenden Arbeitszeit ist! So wie die Besucher*innen erst spät am Abend nach Hause kommen, geht es auch den Musiker*innen, Sänger*innen, Dirigent*innen, dem Einlasspersonal usw. Sie haben allerdings keine fünf Stunden entspannt auf einem bequemen Sitz gesessen und in der Pause ein Glas Sekt genossen, sondern gearbeitet. Und am nächsten Vormittag steht womöglich die nächste Probe mit einem völlig neuen Stück an!
Man fragt sich jetzt vielleicht, was man als Orchestermusiker*in eigentlich verdient. Pauschal lässt sich das natürlich nicht sagen, da die Orchester in Deutschland in verschiedene Tarifvertrags-Kategorien eingeteilt sind. Es gibt A-, B-, C- und D-Orchester, die sich vor allem in der Zahl der festen Stellen unterscheiden. Eine Auflistung der deutschen Berufsorchester findet man auf der Homepage der Deutschen Musik- und Orchestervereinigung unisono. In A-Orchestern wird grundsätzlich am besten gezahlt, aber auch hier gibt es große regionale Unterschiede. Manche Orchester haben einen Haus-Tarifvertrag, der besser als der A-Vertrag (etwa bei Rundfunkorchestern), aber auch schlechter als der D-Vertrag sein kann. In jedem Orchester gibt es außerdem verschiedene Positionen, die unterschiedlich bezahlt werden. Konzertmeister*innen, also die erste Position bei den Violinen, oder Stimmgruppenführer*innen verdienen beispielsweise mehr als Tutti-Positionen, die an den hinteren Pulten sitzen. Grob gesagt zählt man bei einer Stelle in einem größeren Orchester sicherlich zu den Gutverdienern, auch wenn es natürlich sowohl nach oben wie auch nach unten Abweichungen gibt. Innerhalb der Möglichkeiten, die man als klassische Musiker*in auf dem Arbeitsmarkt hat, ist eine feste Stelle als Orchestermusiker*in mit am besten bezahlt und auch am besten abgesichert.
Autor*in
-

Daniel Mattelé studierte Musik mit Hauptfach Harfe an den Musikhochschulen in Weimar, Detmold und München, wo er ein künstlerisches Diplom erwarb. Bis vor der COVID-19-Pandemie war er als freier Orchestermusiker tätig. Zusammen mit seiner Partnerin Laura Oetzel gibt er regelmäßig Kammermusikkonzerte als Harfenduo und betreibt den Blog dasharfenduo.de, auf dem über Themen aus der klassischen Musikszene berichtet wird. Schwerpunkte dieser Berichterstattung sind Beiträge über die #metoo-Bewegung sowie über Arbeitsbedingungen für Musiker:innen.
Bei PRO MUSIK baut Daniel als Mitglied der Redaktionsleitung das PRO MUSIK Magazin auf. Er ist Mitglied bei der Deutschen Orchestervereinigung (DOV) sowie im Verband der Harfenisten in Deutschland e. V.