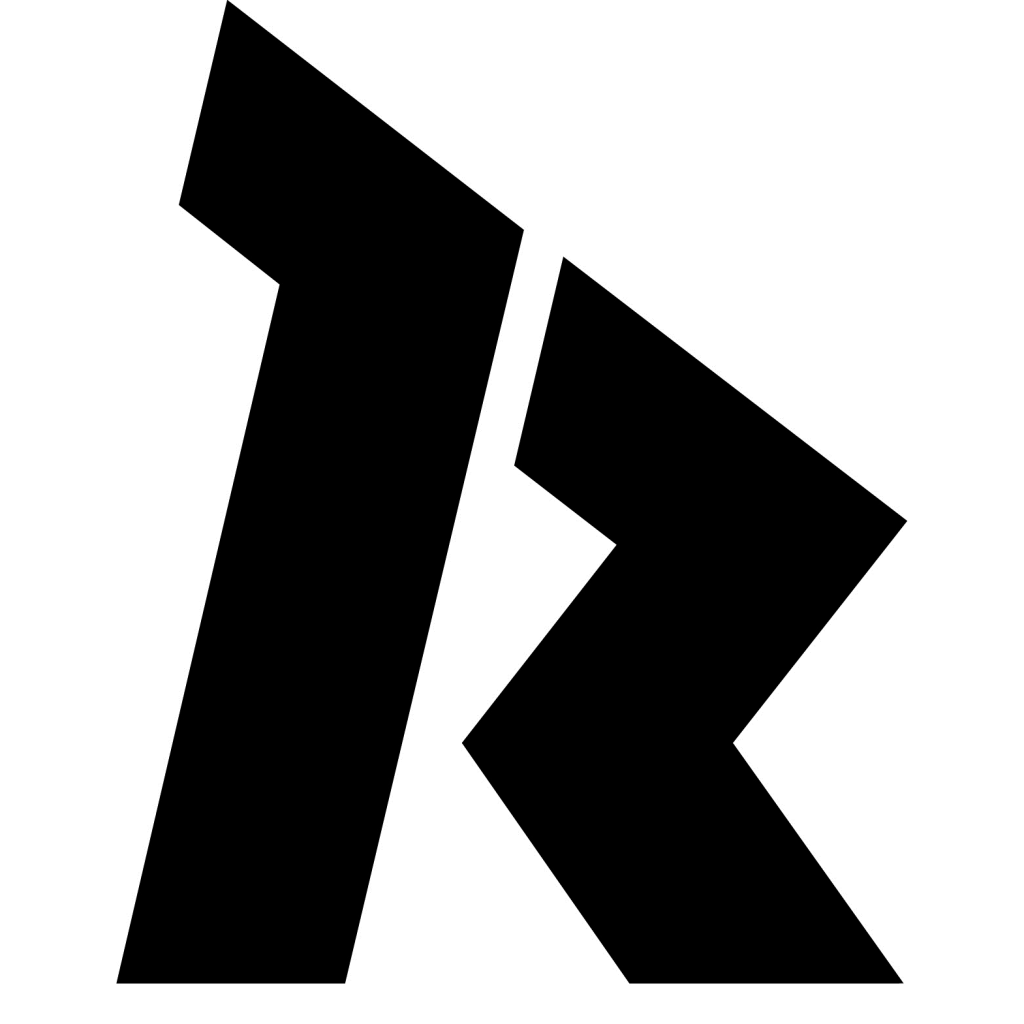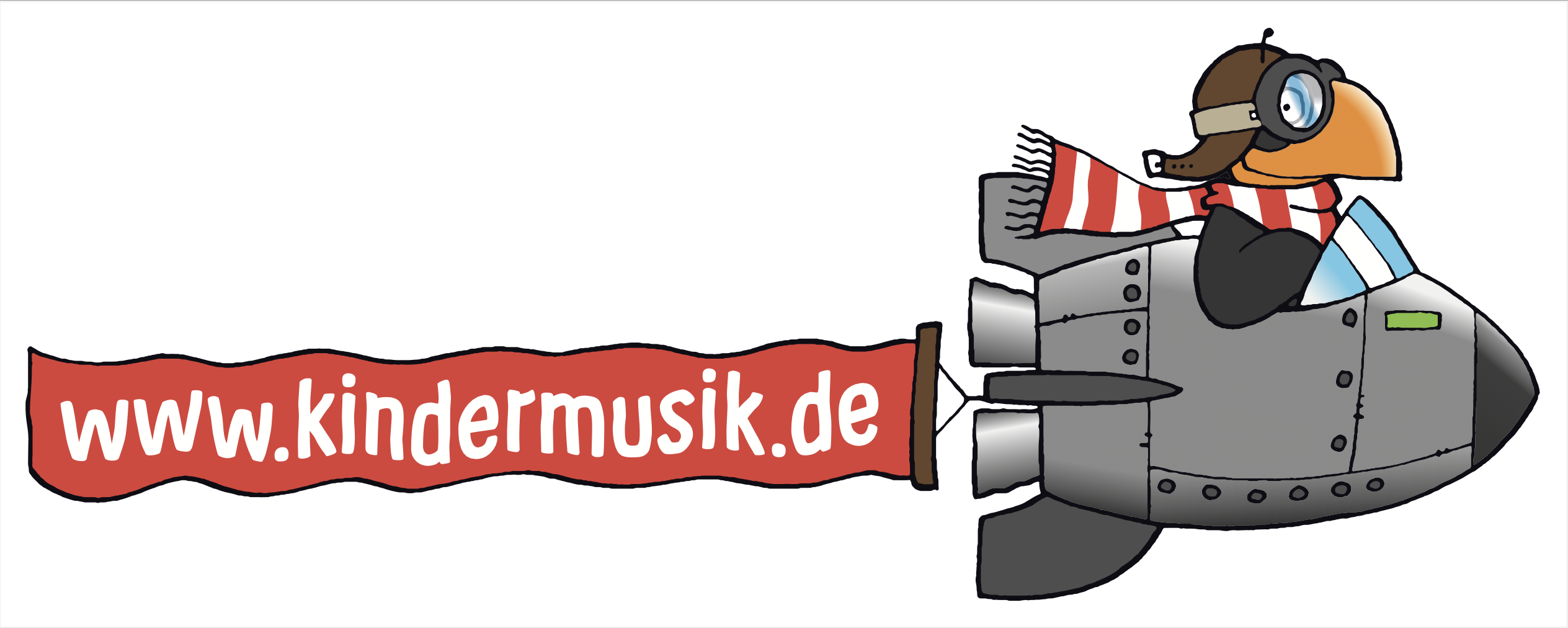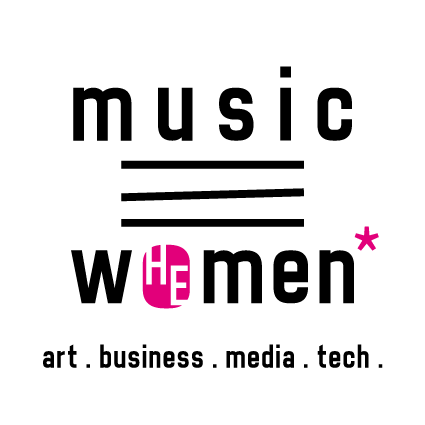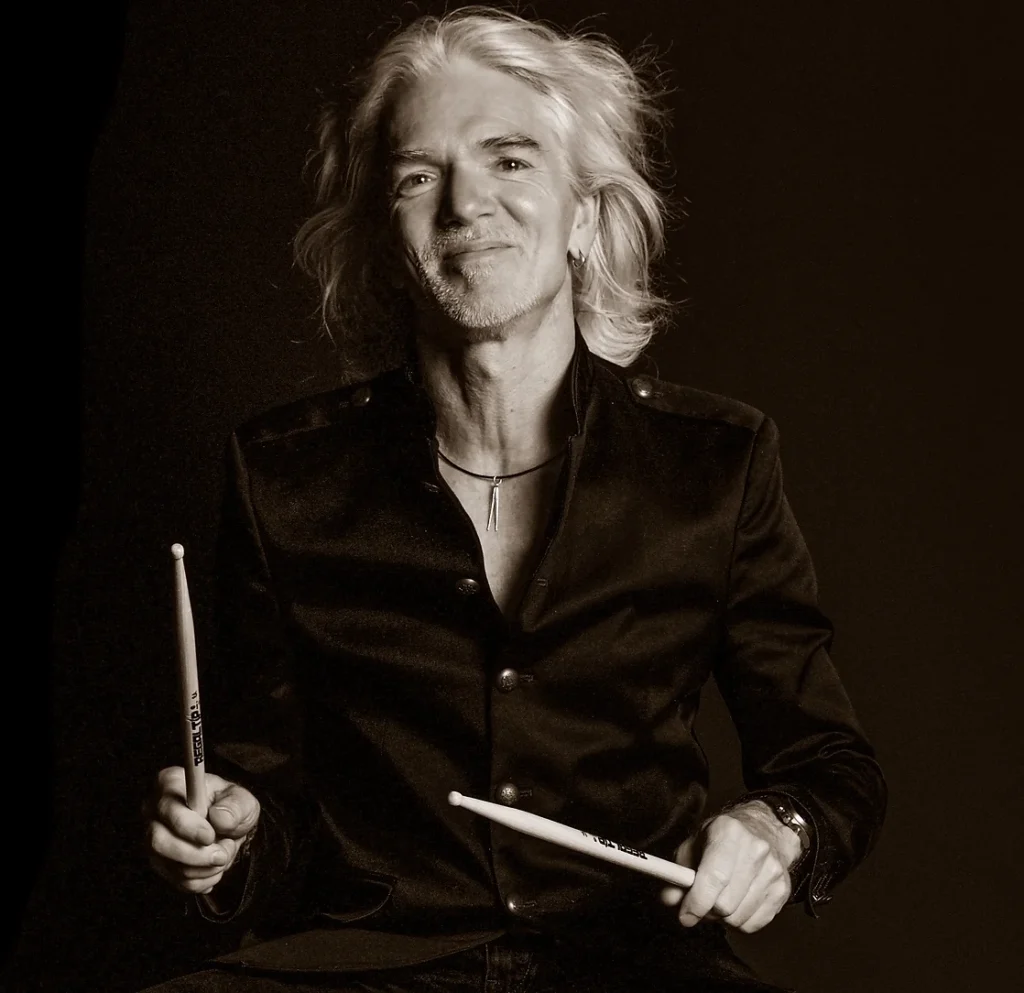Aktualisiert: 22. Okt. 2023
Viele Musikpädagog*innen an öffentlichen Musikschulen sind nicht fest angestellt, sondern arbeiten auf Basis sogenannter Honorarverträge. Im PRO MUSIK Magazin haben wir uns schon mehrfach mit dem Thema beschäftigt, unter anderem in unseren ersten Podcast-Folgen. In diesem Artikel wollen wir auf ein Gerichtsurteil aus Baden-Württemberg eingehen und der Frage nachgehen, ob diese Form von Verträgen überhaupt erlaubt sein kann.
Kurze Zusammenfassung: Was ist ein Honorarvertrag?
Ein Honorarvertrag bietet gegenüber einer Festanstellung viele Nachteile: Der / die Arbeitnehmer*in (bzw. in diesem Fall Auftragnehmer*in) wird nur für die Stunden bezahlt, die er / sie auch tatsächlich gibt. Fällt Unterricht aus – zum Beispiel durch Krankheit, Schwangerschaft oder Mutterschaft – bekommt man ebenso wenig Geld wie in den Ferien und an Feiertagen. Man ist nicht kranken- oder rentenversichert und hat in der Regel kurze Kündigungsfristen und Vertragslaufzeiten. Man trägt also das komplette unternehmerische Risiko – während gleichzeitig die Netto-Stundensätze meist niedriger sind als die der festangestellten Kolleg*innen.
Manche Arbeitgeber*innen und Politiker*innen argumentieren, dass der Honorarvertrag den Musikpädagog*innen Freiheit bei der Ausübung weiterer künstlerischer Tätigkeiten verschaffen würde. In der Realität arbeiten jedoch viele Honorarkräfte ausschließlich und seit vielen Jahren an einer Musikschule, oder sie schließen mehrere Honorarverträge mit verschiedenen Musikschulen ab, um finanziell über die Runden zu kommen. Wolfgang Ruland, ver.di Betriebsgruppen-Sprecher des Forums für Lehrkräfte der Rheinischen Musikschule Köln, machte für die Einführung von Honorarverträgen in unserem Podcast deshalb auch eher Sparmaßnahmen verantwortlich:
„Es kam die Idee auf: Okay, man könnte als öffentlicher Arbeitgeber bestimmte Aufgaben […] in freie Beschäftigung überführen und dadurch bestimmte Kosten einsparen. […] Bei den Musikschulen hat man gesagt: Hier ist ja ein Sparpotenzial, das können wir doch nutzen.“
Es ist auch nicht so, dass man in der Festanstellung alle Freiheit verliert: Rechtzeitig angekündigt, kann man problemlos Unterricht verschieben, wenn man ein Konzert hat.
Scheinselbstständigkeit
Dieses Vertragskonstrukt wirft einige juristische Fragen auf, denn in der Regel kann ein Arbeitgeber nicht ohne weiteres seine Verträge so gestalten, dass er die Sozialabgaben „umgeht“. Der Knackpunkt ist dabei immer, inwieweit die Tätigkeiten der Auftragnehmer*innen noch als „selbstständig“ einzustufen sind. Trifft das nicht zu, spricht man von einer „Scheinselbstständigkeit“. Auf diesen Begriff sind wir in der zweiten Podcast-Folge näher eingegangen. Die Scheinselbstständigkeit kann für den Arbeitgeber zu einem großen Problem werden: Erstens kann eine Honorarkraft sich einklagen, und zweitens können Nachzahlungen von Sozialabgaben drohen.
Es stellt sich nun natürlich die Frage: Haben solche Klagen von Honorarkräften Erfolg? Die Antwort fiel in den letzten Jahren unterschiedlich aus. Es gab Gerichtsurteile, die bei einzelnen Honorarkräften durchaus eine Weisungsgebundenheit und damit Scheinselbstständigkeit festgestellt haben. Das war zum Beispiel der Fall, wenn Honorarkräfte sich ihre Stunden zeitlich nicht selbst einteilen durften oder die Honorare nicht verhandelbar waren. Das bedeutete aber nicht, dass alle Honorarkräfte, auf die dies zutrifft, sich nun einklagen konnten. Andere Gerichte haben in diesen Situationen nämlich auch schon anders entschieden. Doch 2022 gab es ein Urteil des Bundessozialgericht, das die Situation deutlich verändert hat.
Das Herrenberg-Urteil
Im sogenannten „Herrenberg-Urteil“ vom 30.06.2022 stellte das Bundessozialgericht (BSG) nämlich ganz klar fest, dass für eine Scheinselbstständigkeit nicht der Honorarvertrag, sondern der gelebte Arbeitsalltag entscheidend ist. Ein Beispiel: Eine Honorarkraft unterschreibt einen Vertrag, laut dem sie sich ihre Stunden frei einteilen kann. In der Musikschule arbeitet sie in der Realität aber immer montags von 14 Uhr bis 18 Uhr, weil die Raumbelegung keine andere Möglichkeit zulässt. Vor Gericht würde in diesem Fall die Arbeitsrealität stärker berücksichtigt werden als die Vertragsklausel; die Frage, ob die Honorarkraft sich ihre Stunden selbst einteilen kann, müsste dementsprechend verneint werden. Das Gericht bestätigte damit einen Trend, der sich schon in vorangegangenen Urteilen abgezeichnet hatte. Es setzt der Praxis vieler öffentlicher Träger ein Ende, auf entsprechende Urteile mit Anpassungen ihrer Honorarverträge zu reagieren, ohne dass sie den Arbeitsalltag auch tatsächlich ändern.
Das Herrenberg-Urteil ist insofern besonders, als nach Meinung des Bundessozialgerichts die Voraussetzungen einer selbstständigen Tätigkeit mangels unternehmerischer Freiheit schlicht nicht gegeben sind. Bisher haben Gerichte vor allem im Einzelfall den jeweils abgeschlossenen Honorarvertrag bewertet. Diesmal hat das Gericht sich auch noch angeschaut, ob an einer Musikschule überhaupt eine Arbeitsrealität existieren könnte, die Honorarverträge sinnvoll und legal macht. Das Urteil kann so interpretiert werden, dass die Arbeitsbedingungen an öffentlichen Musikschulen einen sozialversicherungsrechtlich konformen Einsatz von Honorarverträgen im Prinzip nicht zulassen.
Folgen für die Musikschullandschaft
Was bedeutet das nun für die öffentlichen Musikschulen und deren Lehrkräfte? Nach wie vor steht Honorarkräften der Weg der Klage offen, wenn sie glauben, scheinselbstständig zu sein. Bisher war es aber sehr ungewiss, ob sie damit Erfolg haben würden. Das scheint sich nun zu ändern. Die eine oder andere Musikschule könnte dem vorgreifen und in Zukunft auf Honorarverträge verzichten. Damit würde sie das Risiko vermeiden, mit – berechtigten – Klagen überzogen zu werden. Es kann natürlich auch sein, dass der Gesetzgeber der Praxis in Zukunft einen Riegel vorschiebt.
Sollte es gar keine Honorarverträge mehr geben, hätte das sicher Folgen für die Musikschullandschaft. Der Arbeitsmarkt würde sich bestimmt verändern und die Finanzierung durch öffentliche Mittel und Gebühren müsste überdacht werden. Aber auch bei einem Szenario mit Honorarverträgen wäre eine Aufstockung der Mittel durch die Politik erforderlich, um für eine faire Bezahlung aller Lehrkräfte zu sorgen. Für das aktuelle Angebot an musikalischer Bildung werden im Moment leider zu wenig Mittel bereitgestellt. Sollten Musikschulen geschlossen oder verkleinert werden, wäre das also nicht auf das Wegfallen der Honorarverträge zurückzuführen, sondern auf die Unterfinanzierung. Die flächendeckende Festanstellung wäre der erste Schritt zu einem Umdenken, von dem am Ende die gesamte Kultur- und Bildungslandschaft profitieren würde.
Signalwirkung auch für andere Branchen?
Ganz grundsätzlich kann man sich sowieso fragen: Ist es nicht ziemlich offensichtlich, dass man eine feste Stelle nicht einfach so in eine selbstständige Tätigkeit umwandeln kann, um Sozialbeiträge zu sparen? Bisher war das nur durch juristische Tricks möglich, die nun nach und nach von Gerichten kassiert werden. Wenn durch die Rückkehr zur Festanstellung auch negative Konsequenzen entstehen, sollte man nicht den Fehler machen, für das bisherige dysfunktionale System zu argumentieren. Aber: Ja, es ist denkbar, dass nicht alle Honorarverträge in feste Stellen umgewandelt werden und einzelne Musiker*innen ihre Tätigkeit nicht wie gewohnt weiter ausüben können. Trotzdem liegen die Vorteile einer Festanstellung für Arbeitnehmer*innen, Arbeitgeber*innen und Musikschüler*innen auf der Hand.
Die Frage der Honorarverträge betrifft im Übrigen nicht nur die Musikschullehrkräfte, sondern viele weitere Arbeitnehmer*innen der Kultur- und Bildungsbranche. Die gleichen Kriterien könnte man durchaus auch auf Lehrbeauftragte an Unis und Hochschulen, Museumsführer*innen oder Lehrkräfte an Volkshochschulen anwenden. Wenn es keine prekäre Beschäftigung mehr geben sollte, müsste sich die Gesellschaft verstärkt mit der Frage auseinandersetzen, was uns Kultur und Bildung wirklich wert sind.
Quellen und weiterführende Informationen
- Der Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs hat in seiner Broschüre „Argumente für die Notwendigkeit sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse an öffentlichen Musikschulen“ die Problematik ausführlich erklärt. Eine kurze Zusammenfassung kann man hier einsehen.
- Das Urteil des Bundessozialgericht vom 30.06.2022 mit dem Aktenzeichen B 12 R 3/20 R (Stadt Herrenberg gegen Deutsche Rentenversicherung Bund) kann man hier einsehen.
- Die Gewerkschaft ver.di hat in ihrer Broschüre „Gute Argumente für Festanstellungen an Musikschulen“ auch noch einmal die Vorteile tariflicher Beschäftigung aufgezeigt. Die Broschüre kann man hier einsehen.
- Die drei Podcast-Folgen des PRO MUSIK Magazins zu dem Thema findet Ihr hier:
- Honorarkräfte an Musikschulen: Leben im Prekariat – Leben in Freiheit?
- Honorarkräfte an Musikschulen: Selbstständig – nur zum Schein?
- Honorarkräfte an Musikschulen: Im Gespräch mit der Stadtverwaltung Sankt Augustin
Autor*innen
-

Daniel Mattelé studierte Musik mit Hauptfach Harfe an den Musikhochschulen in Weimar, Detmold und München, wo er ein künstlerisches Diplom erwarb. Bis vor der COVID-19-Pandemie war er als freier Orchestermusiker tätig. Zusammen mit seiner Partnerin Laura Oetzel gibt er regelmäßig Kammermusikkonzerte als Harfenduo und betreibt den Blog dasharfenduo.de, auf dem über Themen aus der klassischen Musikszene berichtet wird. Schwerpunkte dieser Berichterstattung sind Beiträge über die #metoo-Bewegung sowie über Arbeitsbedingungen für Musiker:innen.
Bei PRO MUSIK baut Daniel als Mitglied der Redaktionsleitung das PRO MUSIK Magazin auf. Er ist Mitglied bei der Deutschen Orchestervereinigung (DOV) sowie im Verband der Harfenisten in Deutschland e. V.
-

Laura Oetzel ist freie Musikerin und lebt in Köln. Sie studierte Harfe an den Musikhochschulen in Weimar und Rostock. Als Pädagogin wie als Künstlerin liegt ihr Schwerpunkt auf der Ensemblemusik. Sie leitet die Harfenklasse der Musikschule der Stadt Sankt Augustin. Als Künstlerin sie hauptsächlich unterwegs mit dem gemeinsamen Harfenduo mit ihrem Partner Daniel Mattelé. Neben ihren Konzerten betreiben die beiden den Blog dasharfenduo.de, auf dem über Themen aus der klassischen Musikszene berichtet wird. Schwerpunkte dieser Berichterstattung sind Beiträge über die #metoo-Bewegung sowie über Arbeitsbedingungen für Musiker:innen.
Laura engagiert sich für bessere Arbeitsbedingungen für freie Musiklehrende, sowohl an ihrer Musikschule als auch in der Landesfachgruppe Musik der Gewerkschaft ver.di. Für PRO MUSIK arbeitet sie in der AG Gleichstellung/Chancengleichheit und in der Redaktionsleitung des PRO MUSIK Magazins. Außerdem ist sie Mitglied im Deutschen Tonkünstlerverband und im Verband der Harfenisten in Deutschland e. V.