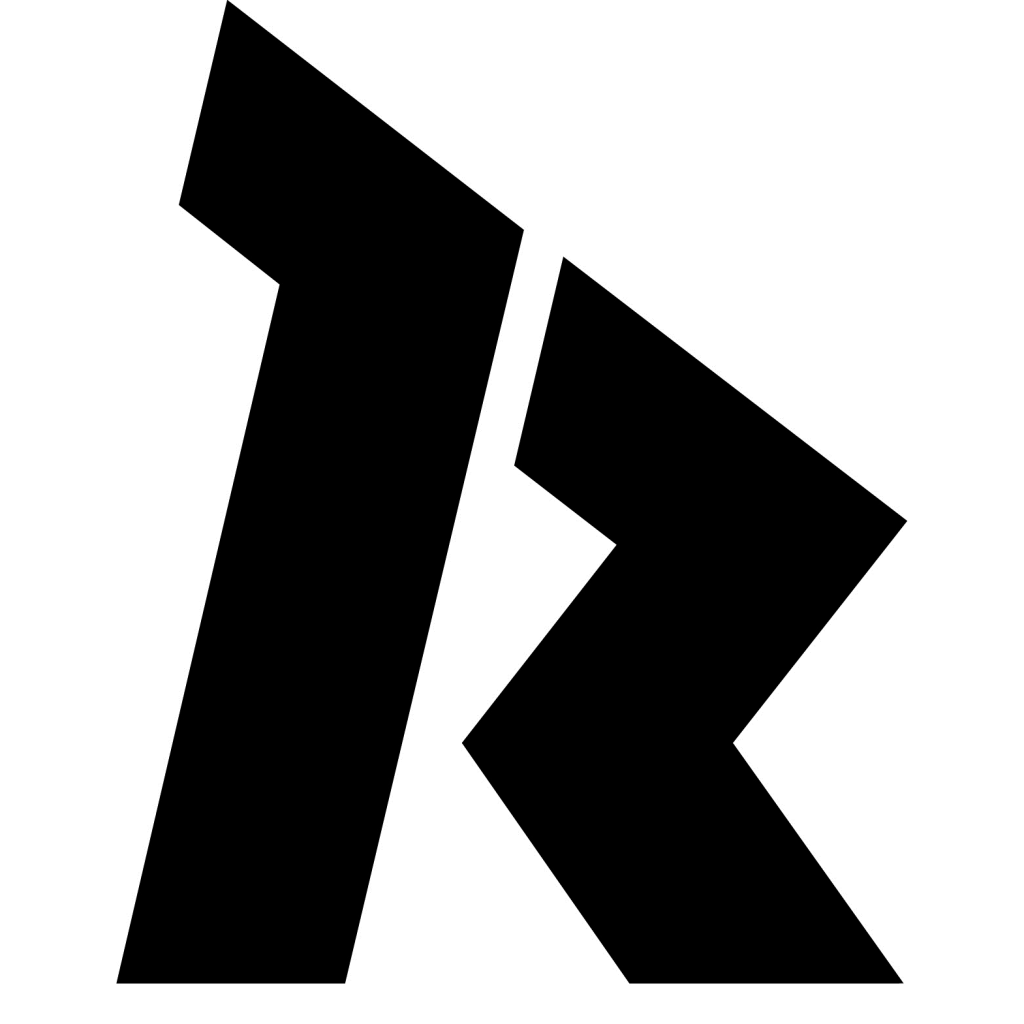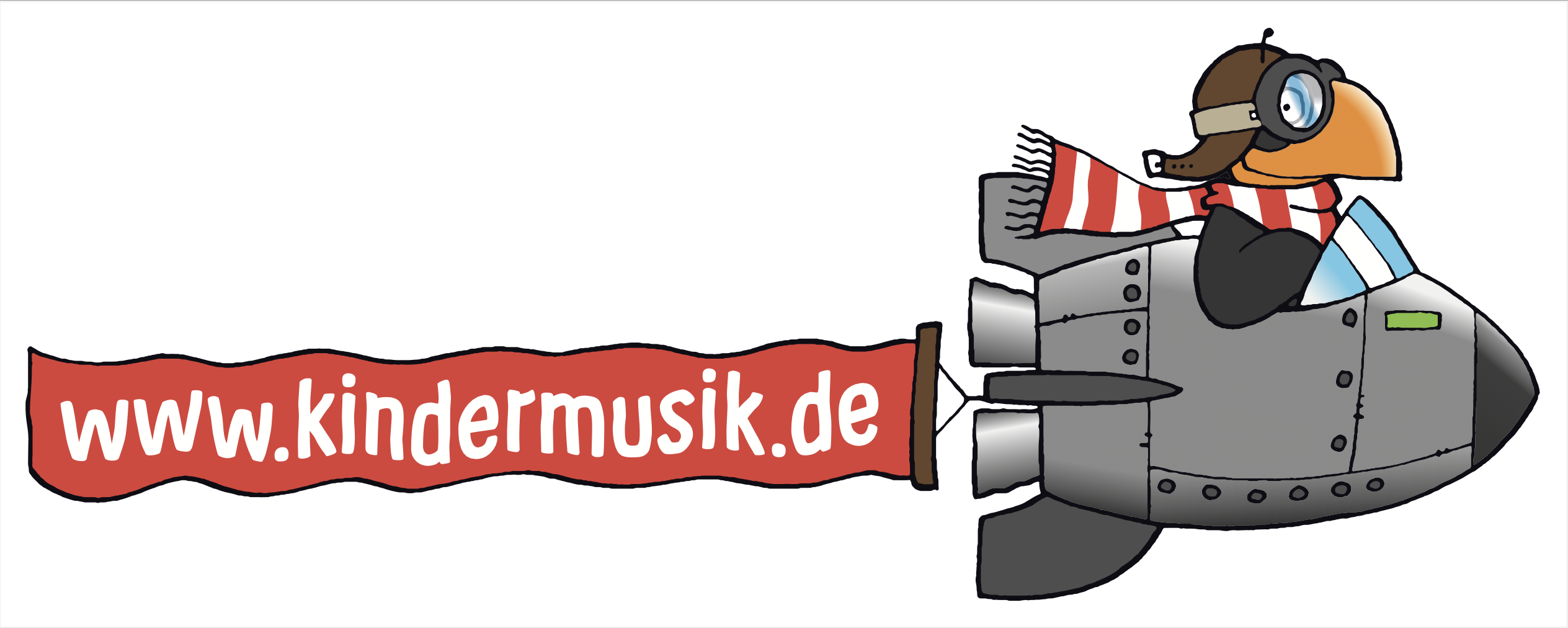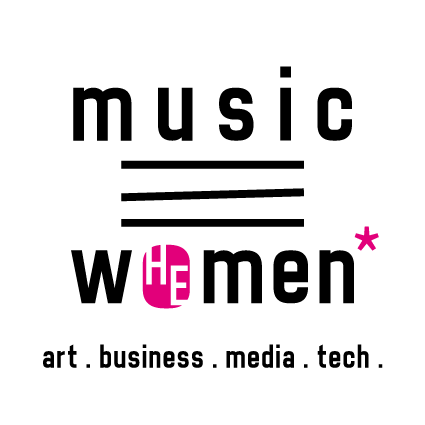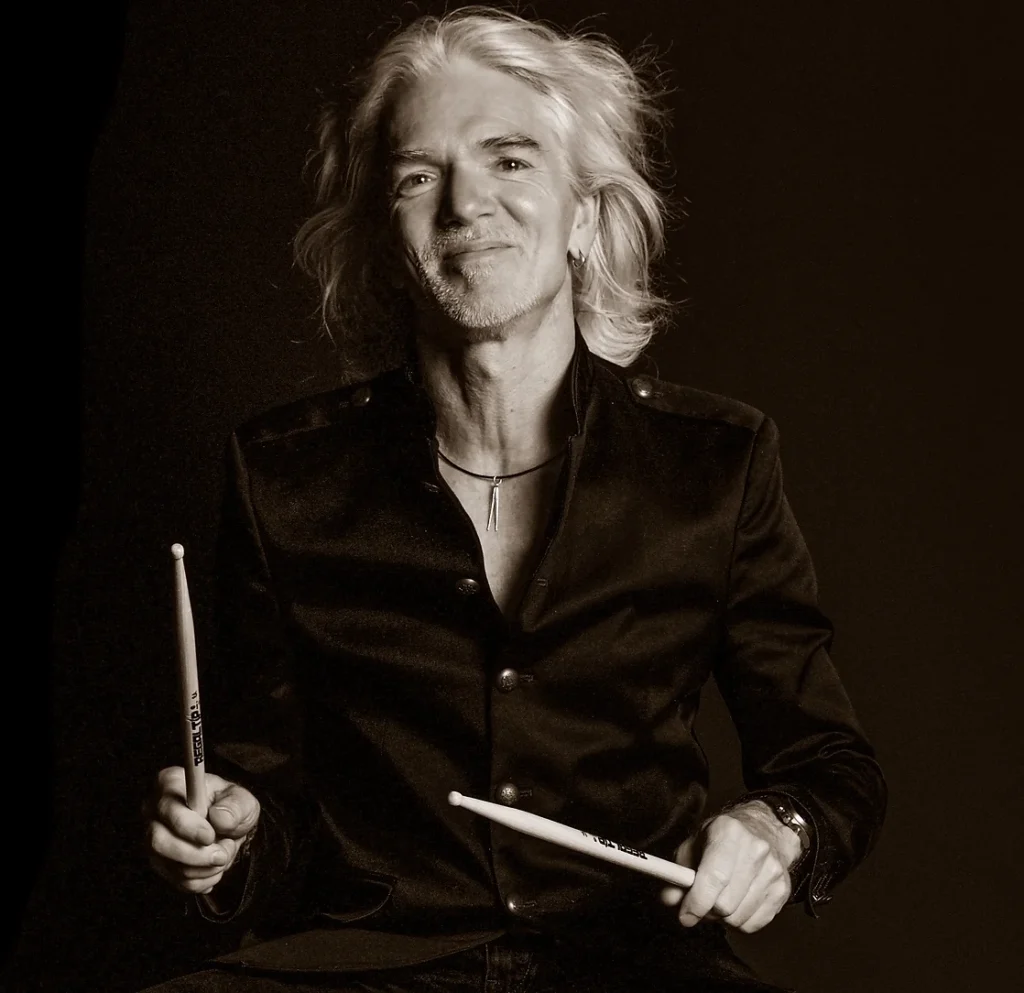Unser Vorstandsmitglied David Trautmann spricht in der CHIP Ausgabe 11/2025 im Artikel “Retorten-Rockstars aus der KI?” über die Chancen und Risiken von KI-Musik
Eine gekürzte Fassung des Interviews steht unten zum Download bereit. Das Magazin ist physisch erhältlich über CHIP SHOP.
CHIP: Wenn man zwischen “Gebrauchsmusik” als Hintergrund für Arbeit, Sport, Reisen etc. und “künstlerischer Musik” (gezielt und bewusst ein Album durchhören; auf Live-Konzert der Lieblingsband gehen etc.) unterscheidet: Ersteres kann KI vielleicht einigermaßen, zweiteres wohl eher nicht. Durch heutige Streaming-Modelle ist der Massenkonsum wirtschaftlich relevanter geworden. Gibt KI-generierte Massenware nun vor allem den freischaffenden, nicht so stark etablierten Künstlerinnen und Künstlern den Rest? Wird es zahlende Kundschaft geben, die sich das noch anhört?
David Trautmann: Ich würde zunächst gern auf die Formulierung der Frage eingehen, denn sie enthält eine gefährliche Entwertung und Abstufung von Kunst. In welchem Kontext Musik gehört wird, sollte zunächst einmal für die Wertschätzung der Künstler*innen völlig egal sein, denn in welcher Form auch immer – sie bereichert ja unser Leben.
Das Problem ist, dass Streaming-Plattformen wie Spotify in erster Linie auf Masse setzen – und Masse heißt: möglichst viele Stunden Content, egal woher er kommt. Wenn dann KI-generierte Hintergrundmusik ohne klare Kennzeichnung in die Kataloge gespült wird, hat das für freischaffende Musiker*innen ganz reale Folgen: Die ohnehin schon winzigen Cent-Bruchteile an Ausschüttungen werden noch weiter zersplittert. Laut Deezer sind bereits rund 20 % der täglichen Uploads KI-generiert – die Gefahr ist also akut!
Gerade die nicht etablierten Musikschaffenden, die sowieso schon am härtesten um Sichtbarkeit und faire Bezahlung kämpfen müssen, trifft das besonders. KI-Massenware kostet nichts in der Herstellung, aber sie drängt sich in denselben Verwertungskanal wie unsere künstlerische Arbeit. Das verschiebt das Gleichgewicht zu Lasten jener, die mit ihrem Schaffen Kultur tragen und erneuern.
Dabei dürfen wir uns nicht von dem Marketing-Narrativ täuschen lassen, das die großen Tech-Giganten hier aufbauen: Sie nennen es „technische Disruption“ – in Wahrheit ist es aber oft Machtmissbrauch. Schon die Entwicklung der Algorithmen basiert auf der Aneignung kreativer Arbeit in Form von Trainingsdaten, ohne faire Gegenleistung. Und jetzt erleben wir, dass dieselben Konzerne erneut ungefragt über unser kulturelles Ökosystem bestimmen. Das ist keine neutrale Innovation, das ist aktive Umverteilung von Wertschöpfung, weg von Kreativen hin zu Tech-Investoren.
Natürlich kann man mit KI auch kreativ arbeiten – das bestreitet niemand. Aber wenn das passieren soll, dann braucht es eine neue Praxis, klare moralische Leitlinien und faire Rahmenbedingungen. Kreative und KI dürfen nicht einfach nur ausgebeutet werden, um kurzfristig Unternehmensprofite zu maximieren. Kultur ist kein Nebenprodukt, das man algorithmisch ausschlachten darf – Kultur ist das Fundament, auf dem wir als Gesellschaft Identität, Vielfalt und Zusammenhalt entwickeln.
CHIP: Kann KI auch neue Chancen bieten? (Etwa für kleinere Künstlerinnen und Künstler, die sich vielleicht keine teuren Studios oder Produzenten leisten können? Könnte KI den Zugang zur Musikwelt demokratisieren, etwa durch Hilfe bei – der ansonsten sehr teuren – Promotion, bei Mixing oder Mastering?)
David Trautmann: Ja, wenn wir sie als Werkzeug verstehen. KI kann Mixing, Mastering, Promotion, aber auch Selbstorganisation und Projektmanagement erleichtern. Viele solcher Technologien gab es schon vor ChatGPT – Machine-Learning-Plugins haben längst auf Audio reagiert, ohne dass man sie ‚KI‘ genannt hat. Jetzt werden diese Tools besser und zugänglicher. Sie können Prozesse vereinfachen, Zeit für Kreativität freisetzen und sogar neue Geschäftsmodelle eröffnen – etwa durch die bewusste Lizenzierung und Vermarktung eigener Stimmen oder Stile. Auch im kreativen Prozess selbst kann KI unterstützen – als eine Art ‚Mit-Autor‘ oder Songwriting-Assistenz, die Ideen für Akkorde, Texte oder Variationen liefert. Das kann das Experimentieren erleichtern und neue Impulse geben. Aber: Der eigene Stil, die Haltung und die Emotionen müssen weiterhin von den Künstler*innen selbst kommen. Nur so bleibt Musik lebendig und unverwechselbar. Chancen entstehen also nur, wenn die tatsächliche Wertschöpfung fair vergütet wird – also die kreative Arbeit von Künstler*innen, die heute im Training von Modellen ungefragt genutzt wird, ebenso wie ihre Musik, die auf Plattformen neben massenhaft KI-Produktionen steht, die ohne Produktionsaufwand eingespeist werden und den ohnehin kleinen Kuchen noch kleiner machen
Sonst ist KI kein Fortschritt, sondern nur ein neues Mittel, künstlerische Arbeit zu entwerten.
CHIP: Wieweit kann KI Künstler auch außerhalb der Musik unterstützen, etwa bei rechtlichen Fragen?
David Trautmann: KI kann Künstler*innen auch jenseits der Musik unterstützen – etwa indem sie unübersichtliche Vertrags- und Lizenztexte scannt, mögliche Konflikte bei Rechten erkennt oder Abrechnungen automatisch analysiert. Erste Tools prüfen bereits komplette Verträge, auch wenn sie noch in den Kinderschuhen stecken. Verbindliche Rechtsberatung bleibt vorerst Sache von Expert*innen. Wichtig ist, dass solche Tools nicht den Eindruck erwecken, sie könnten Verantwortung abnehmen- sondern dass sie Orientierung geben: Wo gibt es kritische Klauseln, wo drohen Rechtekollisionen, wo lohnt es sich, genauer nachzufragen? So bekommen Kreative schneller den Überblick, erkennen Risiken frühzeitig und können gestärkt in echte Verhandlungen gehen.
CHIP: Was bedeutet es für den Wert von Originalität, wenn KI sehr schnell „neue Songs im Stil von …“ erstellen kann?
Das entwertet Originalität, wenn Stilmerkmale ohne Kontext und ohne Beteiligung der Urheber*innen genutzt werden. KI kann imitieren, aber sie versteht keine Biografie, keine Geschichte. Gleichzeitig besteht die Gefahr des Deskilling: Wenn zu viele kreative Prozesse an Maschinen ausgelagert werden, verlieren wir handwerkliche und künstlerisch-ästhetische Fähigkeiten – also genau das praktische und schöpferische Wissen, das Musik einzigartig macht.
Und es gibt ein weiteres Risiko durch Feedback-Schleifen bzw. ‚Model Collapse‘: Wenn KI-Systeme immer wieder mit KI-generierten Inhalten trainiert werden, verarmt die Vielfalt, alles wird glatter, austauschbarer. Für eine lebendige Musikkultur braucht es deshalb weiterhin echte, unverwechselbare Handschriften.
CHIP: Wie können Musiker verhindern, dass ihre Stimme oder ihr Stil ohne Zustimmung in KI-Systemen nachgebildet wird? Suno hat bereits Sperren bei der Generierung eingebaut, wenn beispielsweise ein bestimmter Band- oder Künstlername in der Songbeschreibung enthalten ist. Müssen Sie als Künstler dort proaktiv vorgehen und bei den KI-Diensten vorstellig werden oder gibt es bereits Automatismen?
David Trautmann: Ehrlich gesagt: Momentan gibt es für einzelne Musikschaffende keine wirksamen Möglichkeiten. Natürlich kann man versuchen, ‚No-Training-Klauseln‘ in Verträgen zu verankern oder die eigene Urheberschaft notariell abzusichern – aber das ist teuer, aufwändig und verschiebt die Verantwortung wieder auf das Individuum – und bietet zudem keinerlei Sicherheit in seiner Wirksamkeit gegenüber großen Unternehmen. Ob ein ‚No-Training‘ tatsächlich eingehalten wird, lässt sich nicht überprüfen, und ein Notar hilft dabei auch nicht. Schon ohne KI haben solche Ansätze in der Praxis kaum funktioniert. Besonders kleinere Künstler*innen haben schlicht nicht die Mittel, um Prozesse zu führen. Deshalb ist klar: Der Schutz von Stimme und Stil darf nicht allein auf den Einzelnen abgewälzt werden, sondern muss durch verbindliche rechtliche Rahmen und durchsetzbare Standards gewährleistet sein. Es geht um kollektive Lösungen, nicht um zusätzliche Hürden für ohnehin schon prekär arbeitende Kreative.
CHIP: Haben Sie als Verband bereits juristische Maßnahmen ergriffen gegen offensichtliche “Plagiate”, die durch hohe Klickzahlen viral gingen oder sind Ihnen entsprechende Rechtsstreitigkeiten in Deutschland bekannt?
David Trautmann: Nein, wir selbst haben keine Klagen eingereicht – das ist auch nicht die Aufgabe eines Berufsverbands. Unsere Rolle ist es, die Interessen der Musikschaffenden in ihrer Gesamtheit gegenüber Politik und Gesellschaft zu vertreten, Missstände sichtbar zu machen und Mitglieder bei Bedarf mit Expertise und Netzwerken zu unterstützen. Als Verband sind wir außerdem Mitglied der Initiative Urheberrecht, die sich tiefergehend auf diese Thematik fokussiert. Die eigentlichen Verfahren führen Verwertungsgesellschaften oder Rechteinhaber*innen. Wichtig sind hier vor allem die laufenden Prozesse: GEMA vs. Suno und GEMA vs. OpenAI in Deutschland. Diese Verfahren können zu Präzedenzfällen werden, bei denen sich klärt, wie weit KI-Systeme ohne Lizenz schöpferische Leistungen nutzen dürfen. Für uns ist entscheidend: Es braucht verbindliche Urteile, damit klar wird, dass Kreative nicht schutzlos gegenüber der massenhaften Ausbeutung durch KI stehen.
CHIP: Wie sieht PRO MUSIK die aktuelle Rechtslage: Ist das Urheberrecht im digitalen Zeitalter noch ausreichend, um Künstlerinnen und Künstler vor unrechtmäßiger Nutzung ihrer Werke durch KI zu schützen? Welche politischen oder rechtlichen Rahmenbedingungen wären notwendig, damit sie fair am wirtschaftlichen Erfolg von KI-Anwendungen beteiligt werden?
David Trautmann: Das Urheberrecht in seiner jetzigen Form reicht nicht aus. Es wurde juristisch wie politisch ja in den letzten 20 Jahren bereits verpasst, sinnvolle Weichen für eine faire Vergütung für Musiknutzung im digitalen Raum zu stellen. Allein hier gibt es noch zu viele (zivilrechtliche) Schlupflöcher. Für den Bereich KI sei zu sagen: Das Urheberrecht schützt zwar menschliche Werke, aber nicht die massenhafte, ungefragte Nutzung im Training von KI-Modellen. Das Ergebnis ist eine gefährliche Schieflage: Milliardenschwere Tech-Konzerne schaffen Fakten, während einzelne Musikschaffende kaum die Ressourcen haben, ihre Rechte durchzusetzen. Rechteklärung darf nicht zur Privataufgabe werden.
Wir brauchen daher kollektive, verbindliche Rahmenbedingungen: Transparenz darüber, welche Werke in Trainingsdaten genutzt werden, Vergütungsmodelle mit Opt-in statt Opt-out, und einen echten Schutz von Stimme und Stil als Teil des Persönlichkeitsrechts. Prozesse wie die aktuellen Klagen der GEMA gegen Suno und OpenAI zeigen, wie groß die Lücken sind. Sie sind wichtig als juristische Verfahren, aber sie dürfen nicht die einzige Verteidigungslinie bleiben. Politik muss sicherstellen, dass Kreative nicht erst jahrelang klagen müssen, um ihr Recht zu bekommen.
CHIP: Wie können Verbände, Politik und Gesellschaft Rahmenbedingungen schaffen, damit KI die Musikszene bereichert, statt ihr zu schaden?
David Trautmann: Wir brauchen ein Umfeld, in dem KI ein Werkzeug für Kreative bleibt – nicht ein Ausbeutungsinstrument. Das heißt:
- Transparenzpflichten für Trainingsdaten und klare Herkunftsnachweise bei Outputs.
- Vergütungssysteme, die sicherstellen, dass alle – nicht nur Major-Labels – an den Gewinnen von generativen KI-Anwendungen beteiligt werden.
- KI-Produktionen müssen klar gekennzeichnet werden – nicht nur, damit Hörerinnen wissen, was sie konsumieren, sondern auch, um zu verhindern, dass sie unrechtmäßig Tantiemen beanspruchen, die allein menschlichen Urheber*innen zustehen.
- Sichtbarkeit für Vielfalt: Plattformen müssen so reguliert werden, dass sie nicht billig produzierte KI-Massenware bevorzugen, sondern menschliche Kreativität sichtbar halten.
- Beratung und Bildung: Musikschaffende brauchen Zugang zu Rechts- und Technik-Know-how, um Entscheidungen souverän treffen zu können.
Vor allem aber: Wir dürfen Verantwortung nicht auf Einzelne abwälzen. Der Schutz von Kunst und Kultur ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Wenn Rahmenbedingungen stimmen, kann KI durchaus bereichern – indem sie Prozesse erleichtert, Experimente ermöglicht und neue Geschäftsmodelle schafft. Aber ohne faire Regeln läuft sie Gefahr, Musik auf reines Datenrauschen zu reduzieren.
CHIP: Wenn Sie nach vorn schauen: Wie wird sich Ihrer Meinung nach die Rolle des Musikers in einer zunehmend KI-geprägten Welt verändern?
David Trautmann: Ich glaube, die Rolle von Musikschaffenden wird sich dahin entwickeln, kritisch zu kuratieren und zu gestalten. Wer Kunst macht, muss Haltung zeigen, Verantwortung übernehmen und bewusst entscheiden, wie und wo KI eingesetzt wird. KI kann Routinearbeit übernehmen – aber die Aufgabe der Künstler*innen ist es, zu fühlen, zu erzählen, zu widersprechen. Das Szenario, für das ich eintrete, ist das einer kritischen Musikkultur: Musikschaffende, die die Technologie kennen, sie reflektiert nutzen und trotzdem ihre Handschrift, ihre Biografie und ihre künstlerische Eigenständigkeit ins Zentrum stellen. Nur so bleibt Musik mehr als algorithmisches Rauschen – nämlich gelebte Kultur.
CHIP: Welche Aspekte im Umgang mit KI werden Ihrer Meinung nach oft übersehen?
David Trautmann: Kulturelle Bildung wird viel zu oft übersehen. Es reicht nicht, dass nur Künstler*innen KI verstehen – auch die Gesellschaft muss begreifen, welchen Wert Kultur und Kreativität für uns alle haben. Gleichzeitig brauchen wir ein gemeinsames Verständnis dafür, wie wir mit neuen Technologien umgehen wollen. Es geht nicht darum, Spielräume zu blockieren, sondern darum, dass Ausprobieren und Entwickeln möglich bleibt – nur eben nicht auf Kosten derer, die von ihrer Kunst leben.
Die gesellschaftliche Gefahr ist, dass Kultur denselben Mechanismen folgt wie schon Information und Politik: Algorithmen belohnen Masse und Polarisierung. Das hat in der Politik Spaltungen gefördert, jetzt droht es auch in der Musik. Dazu kommen spezifische Risiken: Deskilling, also der Verlust von Fähigkeiten, wenn kreative Arbeit zu stark an Maschinen delegiert wird und Feedback-Schleifen (‚Model Collapse‘), wenn KI-Systeme immer wieder mit KI-Outputs trainiert werden und dadurch Vielfalt und Qualität verarmen. Wenn wenige Konzerne bestimmen, was sichtbar ist, verlieren wir nicht nur kulturelle Vielfalt, sondern auch demokratische Teilhabe. KI darf nicht zum Brandbeschleuniger für Machtkonzentration werden.